Soziale Herkunft als zentraler Faktor für Bildungserfolg – ein Schlüsselthema der Bildungsforschung
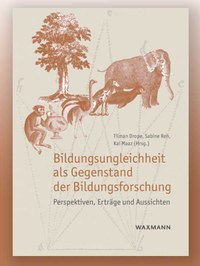
Historischer Wandel, theoretische Vielfalt und praktische Möglichkeiten
Das Werk zeigt, dass sich die Bildungsforschung der sozialen Dimension von Bildung bereits früh gewidmet hat. In Abgrenzung zur geisteswissenschaftlichen Pädagogik der Nachkriegszeit trugen empirische Studien seit den 60er Jahren dazu bei, soziale Benachteiligung sichtbar zu machen. Zwischenzeitlich nahm die Aufmerksamkeit für die Bildungsungleichheit zwar etwas ab, unter anderem weil sich nicht alle bildungspolitischen Erwartungen erfüllten, diese wirksam verringern zu können. Doch spätestens in den 90er Jahren und mit den zur Jahrtausendwende folgenden PISA-Studien wurde die Brisanz des Themas erneut deutlich. Heute lässt sich die Bedeutung des sozialen Hintergrunds für Bildungskarrieren bis ins Erwachsenenalter empirisch umfassend nachzeichnen.
Die Beiträge des Bandes stellen verschiedene theoretische und methodische Zugänge zur Erforschung von Bildungsungleichheit vor. Dabei werden auch normative Grundannahmen reflektiert – etwa die verschiedenen Dimensionen des Begriffs der Bildungsgerechtigkeit. Die Gleichzeitigkeit von Kontinuität und Wandelverdeutlichen bildungshistorisch ausgerichtete Beiträge. Sie zeigen etwa, dass alle sozialen Gruppen langfristig stärker an höherer Bildung teilhaben und dass sich auch für benachteiligte Schichten die Bildungschancen langsam verbessern – trotz eines nach wie vor hohen Zusammenhangs zwischen sozialem Hintergrund und Bildungserfolg.
Mit Blick auf aktuelle Studien werden zudem die Perspektiven standardisierter Forschung in Panelstudien und im Bildungsmonitoring sowie die Erträge qualitativer Schulforschung dargelegt. Dabei wird deutlich, mit welchen Verfahren der Stand und die Entwicklung von Bildungsungleichheit systematisch erfasst werden – etwa auf Grundlage des Nationalen Bildungspanel (NEPS). Gezeigt wird aber auch, wie mit dem Blick auf die Mikroprozesse im Schulalltag mittels Beobachtungen und Interviews das Entstehen und das Erleben von Ungleichheit besser verstanden werden kann.
Diese Einblicke werden abschließend durch Beiträge ergänzt, die die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Schulen bei der Reduzierung von Bildungsungleichheit ausloten und Impulse für Politik, Praxis und Forschung bieten. Im Mittelpunkt stehen hier Schulentwicklungsprojekte, die von Anfang an als Forschungs-Praxis-Partnerschaften entworfen werden und den Sozialraum der Schulen in die Analyse und Entwicklung miteinbeziehen. Dr. Drope greift zwei zentrale Erkenntnisse, die sich aus diesen Darlegungen ziehen lassen, heraus: »Wir können Bildungsungleichheit nur reduzieren, wenn alle beteiligten Ebenen systematisch, langfristig und zielbewusst zusammenarbeiten. Und wir müssen schon sehr früh bei den Kindern ansetzen – und nicht erst im Lauf der Schulzeit, wenn die sozial bedingten Probleme in Bildungsstudien sichtbar werden.«
Der von den DIPF-Wissenschaftler*innen herausgegebene Sammelband mit Beiträgen von Forschenden aus unterschiedlichen Disziplinen und von zahlreichen wissenschaftlichen Einrichtungen ist im Waxmann-Verlag erschienen. Dank der Förderung des Open-Access-Fonds der Leibniz-Gemeinschaft steht er zudem digital frei zugänglich zur Verfügung:
Drope, T., Maaz, K. & Reh, S. (Hrsg.) (2025). Bildungsungleichheit als Gegenstand der Bildungsforschung. Perspektiven, Erträge und Aussichten. Münster: Waxmann. 365 Seiten
Druckausgabe: 39,90 €, ISBN 978-3-8309-4972-5
Online: DOI 10.31244/9783830999720
Mitherausgeber Prof. Dr. Kai Maaz gibt in einem online auf dipf.de verfügbaren Interview nähere Einblicke in die Thematik und damit verbundene Fragen der Bildungsgerechtigkeit:
»Ein Bildungsminimum für alle Kinder und Jugendlichen muss garantiert werden«
Kontakt:
Wissenschaftlicher Ansprechpartner
- Tilman Drope, BBF des DIPF, +49 (0)30 293360-924, dC5kcm9wZUBkaXBmLmRl
Pressekontakt:
- Philip Stirm, DIPF, +49 (0)69 24708-123, c3Rpcm1AZGlwZi5kZQ==
Pressemitteilung vom 10.06.2025